Auch wenn zur Qualitätssteigerung der Software- Projekte in den letzten Jahren ein erheblicher Mehraufwand für das Testen betrieben wurde [1], ist der Weg zu kontinuierlich wiederholbaren Erfolgen keine Selbstverständlichkeit. Stringentes und zielgerichtetes Management aller verfügbaren Ressourcen war und ist bis heute unverzichtbar für reproduzierbare Erfolge.
(c) 2016 Marco Schulz, Java aktuell Ausgabe 4, S.14-19

Es ist kein Geheimnis, dass viele IT-Projekte nach wie vor ihre liebe Not haben, zu einem erfolgreichen Abschluss zu gelangen. Dabei könnte man durchaus meinen, die vielen neuen Werkzeuge und Methoden, die in den letzten Jahren aufgekommen sind, führten wirksame Lösungen ins Feld, um der Situation Herr zu werden. Verschafft man sich allerdings einen Überblick zu aktuellen Projekten, ändert sich dieser Eindruck.
Der Autor hat öfter beobachten können, wie diese Problematik durch das Einführen neuer Werkzeuge beherrscht werden sollte. Nicht selten endeten die Bemühungen in Resignation. Schnell entpuppte sich die vermeintliche Wunderlösung als schwergewichtiger Zeiträuber mit einem enormen Aufwand an Selbstverwaltung. Aus der anfänglichen Euphorie aller Beteiligten wurde schnell Ablehnung und gipfelte nicht selten im Boykott einer Verwendung. So ist es nicht verwunderlich, dass erfahrene Mitarbeiter allen Veränderungsbestrebungen lange skeptisch gegenüberstehen und sich erst dann damit beschäftigen, wenn diese absehbar erfolgreich sind. Aufgrund dieser Tatsache hat der Autor als Titel für diesen Artikel das provokante Zitat von Grady Booch gewählt, einem Mitbegründer der UML.
Oft wenden Unternehmen zu wenig Zeit zum Etablieren einer ausgewogenen internen Infrastruktur auf. Auch die Wartung bestehender Fragmente wird gern aus verschiedensten Gründen verschoben. Auf Management-Ebene setzt man lieber auf aktuelle Trends, um Kunden zu gewinnen, die als Antwort auf ihre Ausschreibung eine Liste von Buzzwords erwarten. Dabei hat es Tom De Marco bereits in den 1970er-Jahren ausführlich beschrieben [2]: Menschen machen Projekte (siehe Abbildung 1).
Wir tun, was wir können, aber können wir etwas tun?
Das Vorhaben, trotz bester Absichten und intensiver Bemühungen ein glückliches Ende finden, ist leider nicht die Regel. Aber wann kann man in der Software-Entwicklung von einem gescheiterten Projekt sprechen? Ein Abbruch aller Tätigkeiten wegen mangelnder Erfolgsaussichten ist natürlich ein offensichtlicher Grund, in diesem Zusammenhang allerdings eher selten. Vielmehr gewinnt man diese Erkenntnis während der Nachbetrachtung abgeschlossener Aufträge. So kommen beispielsweise im Controlling bei der Ermittlung der Wirtschaftlichkeit Schwachstellen zutage.
Gründe für negative Ergebnisse sind meist das Überschreiten des veranschlagten Budgets oder des vereinbarten Fertigstellungstermins. Üblicherweise treffen beide Bedingungen gleichzeitig zu, da man der gefährdeten Auslieferungsfrist mit Personal-Aufstockungen entgegenwirkt. Diese Praktik erreicht schnell ihre Grenzen, da neue Teammitglieder eine Einarbeitungsphase benötigen und so die Produktivität des vorhandenen Teams sichtbar reduzieren. Einfach zu benutzende Architekturen und ein hohes Maß an Automatisierung mildern diesen Effekt etwas ab. Hin und wieder geht man auch dazu über, den Auftragnehmer auszutauschen, in der Hoffnung, dass neue Besen besser kehren.
Wie eine fehlende Kommunikation, unzureichende Planung und schlechtes Management sich negativ auf die äußere Wahrnehmung von Projekten auswirkt, zeigt ein kurzer Blick auf die Top-3-Liste der in Deutschland fehlgeschlagenen Großprojekte: Berliner Flughafen, Hamburger Elbphilharmonie und Stuttgart 21. Dank ausführlicher Berichterstattung in den Medien sind diese Unternehmungen hinreichend bekannt und müssen nicht näher erläutert werden. Auch wenn die angeführten Beispiele nicht aus der Informatik stammen, finden sich auch hier die stets wiederkehrenden Gründe für ein Scheitern durch Kostenexplosion und Zeitverzug.

Der Wille, etwas Großes und Wichtiges zu erschaffen, allein genügt nicht. Die Verantwortlichen benötigen auch die notwendigen fachlichen, planerischen, sozialen und kommunikativen Kompetenzen, gepaart mit den Befugnissen zum Handeln. Luftschlösser zu errichten und darauf zu warten, dass Träume wahr werden, beschert keine vorzeigbaren Resultate.
Große Erfolge werden meist dann erzielt, wenn möglichst wenige Personen bei Entscheidungen ein Vetorecht haben. Das heißt nicht, dass man Ratschläge ignorieren sollte, aber auf jede mögliche Befindlichkeit kann keine Rücksicht genommen werden. Umso wichtiger ist es, wenn der Projektverantwortliche die Befugnis hat, seine Entscheidung durchzusetzen, dies jedoch nicht mit aller Härte demonstriert.
Es ist völlig normal, wenn man als Entscheidungsträger nicht sämtliche Details beherrscht. Schließlich delegiert man die Umsetzung an die entsprechenden Spezialisten. Dazu ein kurzes Beispiel: Als sich in den frühen 2000er-Jahren immer bessere Möglichkeiten ergaben, größere und komplexere Web-Anwendungen zu erstellen, kam in Meetings oft die Frage auf, mit welchem Paradigma die Anzeigelogik umzusetzen sei. Die Begriffe „Multi Tier“, „Thin Client“ und „Fat Client“ dominierten zu dieser Zeit die Diskussionen der Entscheidungsgremien. Dem Auftraggeber die Vorteile verschiedener Schichten einer verteilten Web-Applikation zu erläutern, war die eine Sache. Einem technisch versierten Laien aber die Entscheidung zu überlassen, wie er auf seine neue Applikation zugreifen möchte – per Browser („Thin Client“) oder über eine eigene GUI („Fat Client“) –, ist schlicht töricht. So galt es in vielen Fällen, während der Entwicklung auftretende Missverständnisse auszuräumen. Die schmalgewichtige Browser-Lösung entpuppte sich nicht selten als schwer zu beherrschende Technologie, da Hersteller sich selten um Standards kümmerten. Dafür bestand üblicherweise eine der Hauptanforderungen darin, die Applikation in den gängigsten Browsern nahezu identisch aussehen zu lassen. Das ließ sich allerdings nur mit erheblichem Mehraufwand umsetzen. Ähnliches konnte beim ersten Hype der Service-orientierten Architekturen beobachtet werden.
Die Konsequenz aus diesen Beobachtungen zeigt, dass es unverzichtbar ist, vor dem Projektstart eine Vision zu erarbeiten, deren Ziele auch mit dem veranschlagten Budget übereinstimmen. Eine wiederverwendbare Deluxe-Variante mit möglichst vielen Freiheitsgraden erfordert eine andere Herangehensweise als eine „We get what we need“-Lösung. Es gilt, sich weniger in Details zu verlieren, als das große Ganze im Blick zu halten.
Besonders im deutschsprachigen Raum fällt es Unternehmen schwer, die notwendigen Akteure für eine erfolgreiche Projektumsetzung zu finden. Die Ursachen dafür mögen recht vielfältig sein und könnten unter anderem darin begründet sein, dass Unternehmen noch nicht verstanden haben, dass Experten sich selten mit schlecht informierten und unzureichend vorbereiteten Recruitment-Dienstleistern unterhalten möchten.
Getting things done!
Erfolgreiches Projektmanagement ist kein willkürlicher Zufall. Schon lange wurde ein unzureichender Informationsfluss durch mangelnde Kommunikation als eine der negativen Ursachen identifiziert. Vielen Projekten wohnt ein eigener Charakter inne, der auch durch das Team geprägt ist, das die Herausforderung annimmt, um gemeinsam die gestellte Aufgabe zu bewältigen. Agile Methoden wie Scrum [3], Prince2 [4] oder Kanban [5] greifen diese Erkenntnis auf und bieten potenzielle Lösungen, um IT-Projekte erfolgreich durchführen zu können.
Gelegentlich ist jedoch zu beobachten, wie Projektleiter unter dem Vorwand der neu eingeführten agilen Methoden die Planungsaufgaben an die zuständigen Entwickler zur Selbstverwaltung übertragen. Der Autor hat des Öfteren erlebt, wie Architekten sich eher bei Implementierungsarbeiten im Tagesgeschäft gesehen haben, anstatt die abgelieferten Fragmente auf die Einhaltung von Standards zu überprüfen. So lässt sich langfristig keine Qualität etablieren, da die Ergebnisse lediglich Lösungen darstellen, die eine Funktionalität sicherstellen und wegen des Zeit- und Kostendrucks nicht die notwendigen Strukturen etablieren, um die zukünftige Wartbarkeit zu gewährleisten. Agil ist kein Synonym für Anarchie. Dieses Setup wird gern mit einem überfrachteten Werkzeugkasten voller Tools aus dem DevOps-Ressort dekoriert und schon ist das Projekt scheinbar unsinkbar. Wie die Titanic!
Nicht ohne Grund empfiehlt man seit Jahren, beim Projektstart allerhöchstens drei neue Technologien einzuführen. In diesem Zusammenhang ist es auch nicht ratsam, immer gleich auf die neuesten Trends zu setzen. Bei der Entscheidung für eine Technologie müssen im Unternehmen zuerst die entsprechenden Ressourcen aufgebaut sein, wofür hinreichend Zeit einzuplanen ist. Die Investitionen sind nur dann nutzbringend, wenn die getroffene Wahl mehr als nur ein kurzer Hype ist. Ein guter Indikator für Beständigkeit sind eine umfangreiche Dokumentation und eine aktive Community. Diese offenen Geheimnisse werden bereits seit Jahren in der einschlägigen Literatur diskutiert.
Wie geht man allerdings vor, wenn ein Projekt bereits seit vielen Jahren etabliert ist, aber im Sinne des Produkt-Lebenszyklus ein Schwenk auf neue Techniken unvermeidbar wird? Die Gründe für eine solche Anstrengung mögen vielseitig sein und variieren von Unternehmen zu Unternehmen. Die Notwendigkeit, wichtige Neuerungen nicht zu verpassen, um im Wettbewerb weiter bestehen zu können, sollte man nicht zu lange hinauszögern. Aus dieser Überlegung ergibt sich eine recht einfach umzusetzende Strategie. Aktuelle Versionen werden in bewährter Tradition fortgesetzt und erst für das nächste beziehungsweise übernächste Major-Release wird eine Roadmap erarbeitet, die alle notwendigen Punkte enthält, um einen erfolgreichen Wechsel durchzuführen. Dazu erarbeitet man die kritischen Punkte und prüft in kleinen Machbarkeitsstudien, die etwas anspruchsvoller als ein „Hallo Welt“- Tutorial sind, wie eine Umsetzung gelingen könnte. Aus Erfahrung sind es die kleinen Details, die das Krümelchen auf der Waagschale sein können, um über Erfolg oder Misserfolg zu entscheiden.
Bei allen Bemühungen wird ein hoher Grad an Automatisierung angestrebt. Gegenüber stetig wiederkehrenden, manuell auszuführenden Aufgaben bietet Automatisierung die Möglichkeit, kontinuierlich wiederholbare Ergebnisse zu produzieren. Dabei liegt es allerdings in der Natur der Sache, dass einfache Tätigkeiten leichter zu automatisieren sind als komplexe Vorgänge. Hier gilt es, zuvor die Wirtschaftlichkeit der Vorhaben zu prüfen, sodass Entwickler nicht gänzlich ihrem natürlichen Spieltrieb frönen und auch unliebsame Tätigkeiten des Tagesgeschäfts abarbeiten.
Wer schreibt, der bleibt
Dokumentation, das leidige Thema, erstreckt sich über alle Phasen des Software-Entwicklungsprozesses. Ob für API-Beschreibungen, das Benutzer-Handbuch, Planungsdokumente zur Architektur oder erlerntes Wissen über optimales Vorgehen – das Beschreiben zählt nicht zu den favorisierten Aufgaben aller beteiligten Protagonisten. Dabei lässt sich oft beobachten, dass anscheinend die landläufige Meinung vorherrscht, dicke Handbücher ständen für eine umfangreiche Funktionalität des Produkts. Lange Texte in einer Dokumentation sind jedoch eher ein Qualitätsmangel, der die Geduld des Lesers strapaziert, weil dieser eine präzise auf den Punkt kommende Anleitung erwartet. Stattdessen erhält er schwammige Floskeln mit trivialen Beispielen, die selten problemlösend sind.

Diese Erkenntnis lässt sich auch auf die Projekt-Dokumentation übertragen und wurde unter anderem von Johannes Sidersleben [6] unter der Metapher über viktorianische Novellen ausführlich dargelegt. Hochschulen haben diese Erkenntnisse bereits aufgegriffen. So hat beispielsweise die Hochschule Merseburg den Studiengang „Technische Redaktion“ [7] etabliert. Es bleibt zu hoffen, zukünftig mehr Absolventen dieses Studiengangs in der Projekt-Landschaft anzutreffen.
Bei der Auswahl kollaborativer Werkzeuge als Wissensspeicher ist immer das große Ganze im Blick zu halten. Erfolgreiches Wissensmanagement lässt sich daran messen, wie effizient ein Mitarbeiter die gesuchte Information findet. Die unternehmensweite Verwendung ist aus diesem Grund eine Managemententscheidung und für alle Abteilungen verpflichtend.
Informationen haben ein unterschiedliches Naturell und variieren sowohl in ihrem Umfang als auch bei der Dauer ihrer Aktualität. Daraus ergeben sich verschiedene Darstellungsformen wie Wiki, Blog, Ticketsystem, Tweets, Foren oder Podcasts, um nur einige aufzuzählen. Foren bilden sehr optimal die Frage- und Antwort-Problematik ab. Ein Wiki eignet sich hervorragend für Fließtext, wie er in Dokumentationen und Beschreibungen vorkommt. Viele Webcasts werden als Video angeboten, ohne dass die visuelle Darstellung einen Mehrwert bringt. Meist genügt eine gut verständliche und ordentlich produzierte Audiospur, um Wissen zu verteilen. Mit einer gemeinsamen und normierten Datenbasis lassen sich abgewickelte Projekte effizient miteinander vergleichen. Die daraus resultierenden Erkenntnisse bieten einen hohen Mehrwert bei der Erstellung von Prognosen für zukünftige Vorhaben.
Test & Metriken − das Maß aller Dinge
Bereits beim Überfliegen des Quality Reports 2014 erfährt man schnell, dass der neue Trend „Software testen“ ist. Unternehmen stellen vermehrt Kontingente dafür bereit, die ein ähnliches Volumen einnehmen wie die Aufwendungen für die Umsetzung des Projekts. Genau genommen löscht man an dieser Stelle Feuer mit Benzin. Bei tieferer Betrachtung wird bereits bei der Planung der Etat verdoppelt. Es liegt nicht selten im Geschick des Projektleiters, eine geeignete Deklarierung für zweckgebundene Projektmittel zu finden.
Nur deine konsequente Überprüfung der Testfall-Abdeckung durch geeignete Analyse-Werkzeuge stellt sicher, dass am Ende hinreichend getestet wurde. Auch wenn man es kaum glauben mag: In einer Zeit, in der Software-Tests so einfach wie noch nie erstellt werden können und verschiedene Paradigmen kombinierbar sind, ist eine umfangreiche und sinnvolle Testabdeckung eher die Ausnahme (siehe Abbildung 2).
Es ist hinreichend bekannt, dass sich die Fehlerfreiheit einer Software nicht beweisen lässt. Anhand der Tests weist man einzig ein definiertes Verhalten für die erstellten Szenarien nach. Automatisierte Testfälle ersetzen in keinem Fall ein manuelles Code-Review durch erfahrene Architekten. Ein einfaches Beispiel dafür sind in Java hin und wieder vorkommende verschachtelte „try catch“-Blöcke, die eine direkte Auswirkung auf den Programmfluss haben. Mitunter kann eine Verschachtelung durchaus gewollt und sinnvoll sein. In diesem Fall beschränkt sich die Fehlerbehandlung allerdings nicht einzig auf die Ausgabe des Stack-Trace in ein Logfile. Die Ursache dieses Programmierfehlers liegt in der Unerfahrenheit des Entwicklers und dem an dieser Stelle schlechten Ratschlag der IDE, für eine erwartete Fehlerbehandlung die Anweisung mit einem eigenen „try catch“-Block zu umschliessen, anstatt die vorhandene Routine durch ein zusätzliches „catch“-Statement zu ergänzen. Diesen offensichtlichen Fehler durch Testfälle erkennen zu wollen, ist aus wirtschaftlicher Betrachtung ein infantiler Ansatz.
Typische Fehlermuster lassen sich durch statische Prüfverfahren kostengünstig und effizient aufdecken. Publikationen, die sich besonders mit Codequalität und Effizienz der Programmiersprache Java beschäftigen [8, 9, 10], sind immer ein guter Ansatzpunkt, um eigene Standards zu erarbeiten.
Sehr aufschlussreich ist auch die Betrachtung von Fehlertypen. Beim Issue-Tracking und bei den Commit-Messages in SCM-Systemen der Open-Source-Projekte wie Liferay [11] oder GeoServer [12] stellt man fest, dass ein größerer Teil der Fehler das Grafische User Interface (GUI) betreffen. Dabei handelt es sich häufig um Korrekturen von Anzeigetexten in Schaltflächen und Ähnlichem. Die Meldung vornehmlicher Darstellungsfehler kann auch in der Wahrnehmung der Nutzer liegen. Für diese ist das Verhalten einer Anwendung meist eine Black Box, sodass sie entsprechend mit der Software umgehen. Es ist durchaus nicht verkehrt, bei hohen Nutzerzahlen davon auszugehen, dass die Anwendung wenig Fehler aufweist.
Das übliche Zahlenwerk der Informatik sind Software-Metriken, die dem Management ein Gefühl über die physische Größe eines Projekts geben können. Richtig angewendet, liefert eine solche Übersicht hilfreiche Argumente für Management-Entscheidungen. So lässt sich beispielsweise über die zyklische Komplexität nach McCabe [13] die Anzahl der benötigten Testfälle ableiten. Auch eine Statistik über die Lines of Code und die üblichen Zählungen der Packages, Klassen und Methoden zeigt das Wachstum eines Projekts und kann wertvolle Informationen liefern.
Eine sehr aufschlussreiche Verarbeitung dieser Informationen ist das Projekt Code-City [14], das eine solche Verteilung als Stadtplan visualisiert. Es ist eindrucksvoll Abbildung 3: Maven JDepend Plugin – Zahlen mit wenig Aussagekraft zu erkennen, an welchen Stellen gefährliche Monolithe entstehen können und wo verwaiste Klassen beziehungsweise Packages auftreten.
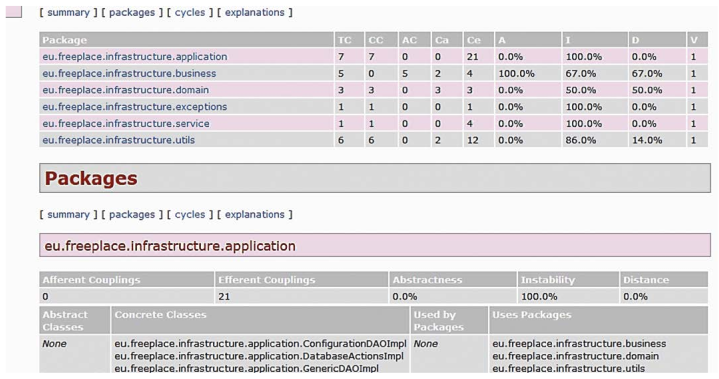
Fazit
Im Tagesgeschäft begnügt man sich damit, hektische Betriebsamkeit zu verbreiten und eine gestresste Miene aufzusetzen. Durch das Produzieren unzähliger Meter Papier wird anschließend die persönliche Produktivität belegt. Die auf diese Art und Weise verbrauchte Energie ließe sich durch konsequent überlegtes Vorgehen erheblich sinnvoller einsetzen.
Frei nach Kants „Sapere Aude“ sollten einfache Lösungen gefördert und gefordert werden. Mitarbeiter, die komplizierte Strukturen benötigen, um die eigene Genialität im Team zu unterstreichen, sind möglicherweise keine tragenden Pfeiler, auf denen sich gemeinsame Erfolge aufbauen lassen. Eine Zusammenarbeit mit unbelehrbaren Zeitgenossen ist schnell überdacht und gegebenenfalls korrigiert.
Viele Wege führen nach Rom – und Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Es lässt sich aber nicht von der Hand weisen, dass irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist, den ersten Spatenstich zu setzen. Auch die Auswahl der Wege ist kein unentscheidbares Problem. Es gibt sichere Wege und gefährliche Pfade, auf denen auch erfahrene Wanderer ihre liebe Not haben, sicher das Ziel zu erreichen.
Für ein erfolgreiches Projektmanagement ist es unumgänglich, den Tross auf festem und stabilem Grund zu führen. Das schließt unkonventionelle Lösungen nicht grundsätzlich aus, sofern diese angebracht sind. Die Aussage in Entscheidungsgremien: „Was Sie da vortragen, hat alles seine Richtigkeit, aber es gibt in unserem Unternehmen Prozesse, auf die sich Ihre Darstellung nicht anwenden lässt“, entkräftet man am besten mit dem Argument: „Das ist durchaus korrekt, deswegen ist es nun unsere Aufgabe, Möglichkeiten zu erarbeiten, wie wir die Unternehmensprozesse entsprechend bekannten Erfolgsstories adaptieren, anstatt unsere Zeit darauf zu verwenden, Gründe aufzuführen, damit alles beim Alten bleibt. Sie stimmen mir sicherlich zu, dass der Zweck unseres Treffens darin besteht, Probleme zu lösen, und nicht, sie zu ignorieren.“ … more voice
Referenzen
