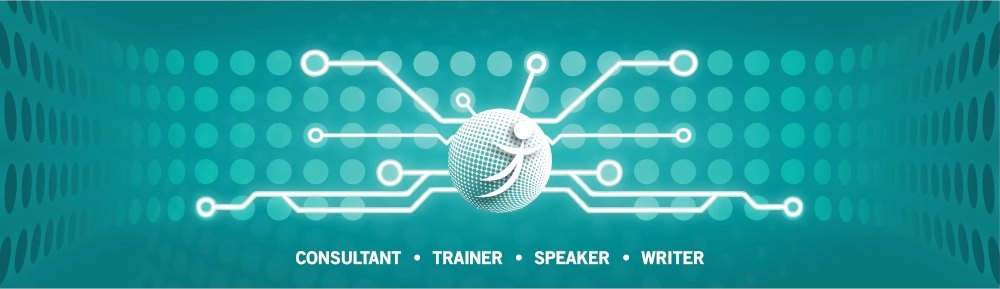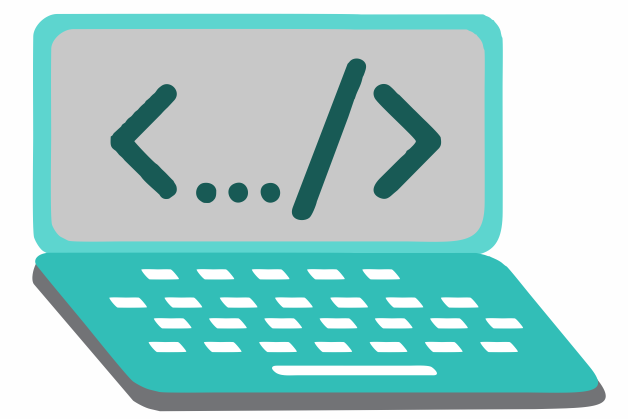Als ich das erste Mal den Begriff Vibe Coding las, dachte ich erst an Kopfhörer, chillige Musik und den Übertritt in den Flow. Der absolute Zustand der Kreativität dem Programmierer hinterherjagen. Ein Rausch der Produktivität. Aber nein, es wurde mir recht schnell klar, es geht um etwas anderes.
Vibe Coding nennt man das, was man einer KI über den Prompt eingibt, um ein benutzbares Programm zu erhalten. Die Ausgabe des Large Language Models (LLM) ist dann noch nicht gleich das ausführbare Programm, sondern nur der entsprechende Quelltext in der Programmiersprache, die der Vibe Coder vorgibt. Daher braucht der Vibe Coder je nachdem, auf welcher Plattform er unterwegs ist, noch die Fähigkeit, das Ganze zum Laufen zu bringen.
Seitdem ich in der IT aktiv bin, gibt es den Traum der Verkäufer: Man bräuchte keine Programmierer mehr, um Anwendungen für den Kunden zu entwickeln. Bisher waren alle Ansätze dieser Art wenig erfolgreich, denn egal was man auch tat, es gab keine Lösung, die vollständig ohne Programmierer ausgekommen ist. Seit der allgemeinen Verfügbarkeit von KI‑Systemen hat sich einiges geändert und es ist nur eine Frage der Zeit, bis man von den LLM-Systemen wie Copilot etc. auch ausführbare Anwendungen geliefert bekommt.
Die Möglichkeiten, die sich durch Vibe Coding eröffnen, sind durchaus beachtlich, wenn man weiß, was man da tut. Gleich aus Goethes Zauberlehrling, der der Geister, die er rief, nicht mehr Herr geworden ist. Werden Programmierer nun obsolet? Auf absehbare Zeit denke ich nicht, dass der Beruf Programmierer aussterben wird. Es wird sich aber einiges verändern und die Anforderungen werden sehr hoch sein.
Ich kann definitiv sagen, dass ich der KI Unterstützung beim Programmieren offen gegenüberstehe. Allerdings haben mich meine bisherigen Erfahrungen gelehrt, sehr vorsichtig zu sein mit dem, was die LLMs so als Lösung vorschlagen. Möglicherweise liegt es daran, dass meine Fragen sehr konkret und für spezifische Fälle waren. Die Antworten waren durchaus hin und wieder ein Fingerzeig in eine mögliche Richtung, die sich als erfolgreich herausgestellt hat. Aber ohne eigenes Fachwissen und Erfahrung wären alle Antworten der KI nicht nutzbar gewesen. Auch Begründungen oder Erläuterungen sind in diesem Kontext mit Vorsicht zu genießen.
Es gibt mittlerweile diverse Angebote, die den Leuten den Umgang mit künstlicher Intelligenz beibringen wollen. Also in Klartext, wie man einen funktionierenden Prompt formuliert. Ich halte solche Offerten für unseriös, denn die LLM wurden ja dafür entwickelt, natürliche (menschliche) Sprache zu verstehen. Was soll man also lernen, vollständige und verständliche Sätze zu formulieren?
Wer eine ganze Anwendung über Vibe Coding erstellt, muss diese ausgiebig testen. Also sich durch die Funktionen klicken und schauen, ob alles so funktioniert, wie es soll. Das kann durchaus zu einer sehr nervenden Beschäftigung ausarten, die mit jedem Durchlauf lästiger wird.
Auch die Verwendung von Programmen, die durch Vibe Coding erstellt wurden, ist unproblematisch, solange diese lokal auf dem eigenen Computer laufen und nicht als kommerzieller Internetservice frei zugänglich sind. Denn genau hier lauert die Gefahr. Die durch Vibe Coding erstellten Programme sind nicht ausreichend gegen Hackerangriffe gesichert, weswegen man sie nur in geschlossenen Umgebungen betreiben sollte. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass künftig in sicherheitskritischen Umgebungen wie Behörden oder Banken die Verwendung von Programmen, die Vibe Coded sind, zu verbieten. Sobald die ersten Cyberattacken auf Unternehmensnetzwerke durch Vibe Coding Programme bekannt werden, sind die Verbote gesetzt.
Neben der Frage zur Sicherheit von Vibe-Coding-Anwendungen werden Anpassungen und Erweiterungen nur mit großem Aufwand umzusetzen sein. Dieses Phänomen ist in der Softwareentwicklung gut bekannt und tritt bei sogenannten Legacy Anwendungen regelmäßig auf. Sobald man hört, dass ist historisch gewachsen ist, man auch schon mitten drin. Fehlende Strukturen und sogenannte technische Schulden lassen ein Projekt über die Zeit so erodieren, dass sich die Auswirkungen von Änderungen nur sehr schwer auf die restlichen Funktionen abschätzen lassen. So ist zu vermuten, dass es in Zukunft sehr viele Migrationsprojekte geben wird, die die KI erstellten Codebasen wieder in saubere Struckturen überführen. Deswegen eignet sich Vibe Coding vor allem für die Erstellung von Prototypen, um Konzepte zu testen.

Mittlerweile gibt es auch Beschwerden in Open Source Projekten, dass es hin und wieder zu Contributions kommt, die nahezu die halbe Codebasis umstellen und fehlerhafte Funktionen hinzufügen. Hier helfen natürlich zum einen der gesunde Menschenverstand und die vielen in der Softwareentwicklung etablierten Standards. Es ist ja nicht so, dass man im Open Source nicht schon früher Erfahrung mit schlechten Code Commits gesammelt hätte. Dadurch kam der Diktaturship-Workflow für Werkzeuge wie Git, das von der Codehosting Plattform GitHub in Pull Request umbenannt wurde.
Wie kann man also schnell schlechten Code erkennen? Mein derzeitiges Rezept ist die Überprüfung der Testabdeckung für hinzugefügten Code. Kein Test, kein Codemerge. Natürlich können auch Testfälle Vibe Coded sein oder es fehlen notwendige Assertions, auch das lässt sich mittlerweile gut automatisiert erkennen. In den vielen Jahren in Softwareentwicklungsprojekten habe ich genügend erlebt, dass mir kein Vibe Coder auch nur annähernd Schweißperlen auf die Stirn treiben kann.
Mein Fazit zum Thema Vibe Coding lautet: Es wird in Zukunft einen Mangel an fähigen Programmierern geben, die Unmengen an schlechtem Produktivcode gerade biegen sollen. Also auf absehbare Zeit noch kein aussterbender Beruf. Dem gegenüber werden durchaus ein paar clevere Leute für das eigene Business sich mit einfachen Informatikkenntnissen ein paar leistungsfähige Insellösungen zusammenscripten, die zu Wettbewerbsvorteilen führen werden. Während wir diese Transformation erleben, wird das Internet weiterhin zugemüllt und die Perlen, von denen Weizenbaum einst gesprochen hat, schwerer zu finden sein.